Bauvorschlag für einen Drehtisch
Wie
bereits gezeigt, können Stereoaufnahmen mit
Hilfe eines Drehtisches erstellt werden. An einen solchen Drehtisch
sind eine Reihe
von Anforderungen zu stellen:
Er muss stabil und präzise sein.
Insbesondere hat die Drehung um einen sauber definierten Mittelpunkt zu
erfolgen, d.h. die Achse darf kein merkliches Spiel haben. Will man den
Konvergenzwinkel des Stereomikroskops realisieren, muss die Tischebene genau
senkrecht zur Drehachse liegen.
Die Drehung ist mit hoher Genauigkeit auf
180 Grad zu beschränken. Weicht die Drehung des Drehtisches von 180° ab, so
sind die Achsen der Halbbilder nicht mehr korrekt ausgerichtet. Es entstehen
Bildfehler wie bei einer Stereokamera, bei der die beiden Einzelkameras
gegeneinander verkippt sind, so dass sie keine parallele Horizontlinie mehr
besitzen. Eine Drehung um einen Winkel, der größer oder kleiner als 180 Grad
ist, führt bei der Ausrichtung der Bilder zudem zwangsläufig zu einem
Verlust an Bildfläche. Bei einer Drehung des Tisches um 180 Grad ist bei
der Montage der Einzelbilder zu einem Stereobild nur eine einfache Drehung
um 180° auszuführen.
Der Tisch sollte sich gut in den Fuß des
Stereomikroskops einsetzen lassen. Nach Möglichkeit sollte er im
Mittel-
Realisierung
Ich habe mich entschlossen, als wesentliches Element ein Kugellager
(Rillenkugellager, mit Innendurchmesser d=50mm und Außendurchmesser
D=80mm, Breite B=16mm) einzusetzen, das man günstig bei eBAY ersteigern
kann. Die Maße sind nicht kritisch und müssen nur in etwa zum Fuß des
verwendeten Stereomikroskops passen. Die Tischober- und Unterseite bilden kreisförmige Glasscheiben, die man sich geeignet
zuschneidet und entgratet oder beim Glaser für wenig Geld anfertigen lässt. Der
Boden ist so zu wählen, dass er sich spielfrei in den Fuß
des Mikroskops einsetzen lässt. Wahlweise kann man auch eine kreisförmige
Scheibe aus Glas oder Metall als Boden verwenden, die in der Mitte eine
kreisförmige Aussparung besitzt. Das bietet den Vorteil einer
Reinigungsmöglichkeit. Die Tischober- und Unterseite werden an beiden
Seiten des Kugellagers befestigt.
In der nebenstehenden Zeichnung
ist die von mir gewählte Realisierung zu sehen. Die im Querschnitt rot
dargestellten ringförmigen Zwischenstücke verbinden Kugellager und
Glasscheiben und sorgen für den notwendigen Abstand. Damit nämlich nichts
schleift, benötigt man einen sehr geringen Abstand zwischen Tischplatten
und Lager. Beabsichtigt waren hier dünne Metallfolien. Provisorisch habe ich
doppelseitiges Klebeband verwendet und bekanntlich lebt nichts länger als
ein gutes Provisorium. Das Band hält so gut, dass ich immer noch mit diesem
„Provisorium“ arbeite.
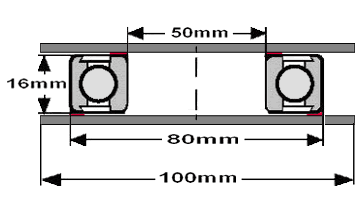
Zusammenbau
Zuerst wird die Tischoberseite auf den Kugellager befestigt.
Die Positionierung der Tischplatte ist völlig unkritisch. Ein Blatt Papier
mit Kreisen hilft bei der Zentrierung.
Im nächsten Schritt wird möglichst exakt der Durchstoßpunkt
der Drehachse durch die Tischplatte (Drehpunkt) gesucht und mit einem Fineliner (wie er zur Beschriftung von CDs angeboten wird) markiert. Die
exakte Bestimmung dieses Punktes gelingt unter dem Stereomikroskop. Der
Boden wird dazu provisorisch befestigt und das Lager gedreht. Die Markierung
darf ihre Lage dabei nicht verändern. Das endgültige Montieren des Bodens wird ebenfalls unter Mikroskopbeobachtung
durchgeführt. Es wird mit einem Okular mit Fadenkreuz die
Mittelpunktsmarkierung der Tischoberseite in den Mittelpunkt des
Bildes gebracht und dann der Boden in dieser Lage fixiert. Danach sind nur
noch Korrekturen durch Schwenken des Stereomikroskops um seine vertikale
Befestigung möglich. Man könnte auch daran denken, durch leicht exzentrische
Montierung und Drehung des ganzen Drehtisches in Verbindung mit einem
Schwenken des Stereomikroskops um seine vertikale Befestigung eine spätere
Justierung zu ermöglichen, aber das ist sicher nicht der eleganteste Weg.
Verwendet man einen Fototubus, wird die Justierarbeit zweckmäßig mit
Okulareinblick am Fototubus ausgeführt, denn auf den kommt es bei
Stereoaufnahmen an. Leider kann man nicht immer davon ausgehen,
dass die Mittelpunkte des visuellen Einblicks und des Fototubus exakt
übereinstimmen.
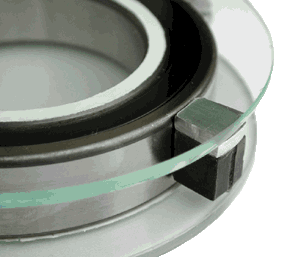
Seitliche Anschläge
Zur Eingrenzung der Drehung auf
180 Grad wurde ein Finger an der Unterseite der Tischplatte angeklebt und
weiterhin zwei Anschläge auf der Tischauflage. Zur Erreichung einer
definierten Endstellung ist der Finger als Magnet (genauer gesagt sind zwei
Magneten im Keil zusammengeklebt) ausgeführt. Dieser Finger ist links im
Bild zu sehen. Die Anschläge sind
Schraubenköpfe, die eine einfache und sehr genaue Justierung ermöglichen.
Mindestens ein Anschlag sollte justierbar sein. Die Haltekraft darf nicht zu groß sein, sonst
ist ruckfreies Arbeiten später nicht möglich. Notfalls kann man eine dünne
Scheibe als Abstandshalter dazwischensetzen. Die Begrenzung der Drehung auf
180° wird wieder mittels Fadenkreuzokulars eingestellt. Eine genaue
Justierung gelingt auch mit Hilfe von Fotos eines flachen Motivs , die in
den Endpositionen angefertigt werden. Nach Drehung eines der Bilder um
180° müssen sie sich durch Verschiebung zur Deckung bringen lassen.
Bohrungen im Glas sind nicht erforderlich. Für die Klebearbeiten am Glas
eignen sich Zwei-
Rechts ist der fertige Drehtisch zu sehen.
Man muss schließlich nur noch darauf achten, dass der Drehtisch so fest im Fuß sitzt, dass die Tischauflage sich nicht während der Arbeit dreht oder verschiebt. Ich hatte das Glück, dass die Bodenplatte so exakt im Fuß des Stereomikroskops sitzt, dass irgendwelche zusätzliche Befestigungselemente nicht benötigt werden. In der Regel wird man eine Klemmung oder einen Halterahmen benötigen. Die Haftreibung durch das Eigengewicht ist mit Sicherheit nicht ausreichend, um den Tisch ohne jede Befestigung zu betreiben.


Beleuchtung
Besonderer Beachtung bedarf die Beleuchtung. Schon bei der Wippe, wie sie
auf der vorhergehenden Seite beschrieben ist, sind bei
einer feststehenden Beleuch-
Wie das Bild oben zeigt, habe ich einen
LED Lenser von Optoeletronics mit einem Aluclip am Rand des Tellers
befestigt. Mittels seines flexiblen Halses kann er gut auf das Objekt
ausgerichtet werden.
Eine weitere LED-Taschenlampe wurde über eine einfache verstellbare
Halterung auf dem Drehteller angebracht. Die Lampe sitzt fest in einer
Manschette. Mit einem Zwischenstück aus Aluminium ist die Lampe auf
einen Fuß aufgesetzt, der auf die Glasplatte aufgeklebt wurde. Dabei steckt
ein Zapfen drehbar in einer Buchse und kann mittels einer Flügelschraube
arretiert werden. Im Bild rechts ist zu erkennen, dass die Lampe gut auf das
Objekt ausgerichtet werden kann. Obwohl diese LED-


Mit beiden Lampen lassen sich die
meisten Beleuchtungsprobleme lösen. Links sieht man den Tisch mit beiden
Lampen. Allerdings wird die Handhabung des Tisches durch die Aufbauten erschwert.
Man muss beim Drehen darauf achten, das Objekt nicht zu
verschieben und die Ausrichtung der Beleuchtung nicht zu verändern. Der
Tisch muss so in den Fuß des Stereomikroskops eingesetzt werden, dass die
große Taschenlampe nicht mit dem Stativ kollidiert.
Die Helligkeit der verwendeten Taschenlampen ist für die visuelle
Beobachtung etwas zu schwach ausgelegt. Für fotografische Zwecke ist sie
hingegen völlig ausreichend, zumal ich die Kamera nicht von Hand auslöse, sondern
grundsätzlich über einen PC steuere. Die Steuerung durch den PC mit
unmittelbaren Download des Bildes halte ich auch bei kurzen
Belichtungszeiten ohne Gefahr des Verwackelns für die beste Methode. Vor
dem Drehen des Tisches kann man sich versichern, dass die Aufnahme gelungen
ist.
Geneigter Drehtisch
Will man von dem Konvergenzwinkel abweichen, der durch das
Stereomikroskop vorgegeben ist, kann man das durch einen zusätzlichen Tisch
erreichen, auf den der oben beschriebene Drehtisch aufgesetzt wird. Die
Konstruktion ist rechts im Bild zu sehen. Die runde Bodenplatte sitzt
in einer flachen Aussparung. Die einseitige Höhenverstellung geschieht mittels zweier
Schrauben auf der linken Seite des Zwischentisches. Kleinere Schwierigkeiten
bereitet die feste Montage auf dem Fuß des MBS-10. Damit der ganze Aufbau
nicht verrutscht, habe ich mit kleinen Schraubklemmen experimentiert. Ich
muss aber zugeben, dass sich ein paar Klebestreifen rechts und links besser
bewährt haben. Einen definierten Anstellwinkel erreicht man durch Messung
der Tischhöhe rechts und links in einem bestimmten Abstand. Dazu verwende
ich die Tiefenmessung der Schieblehre. Der Anstellwinkel ergibt sich aus
dem Arcustangens der Steigung, der bei den kleinen Winkeln in linearer
Näherung berechnet werden kann.
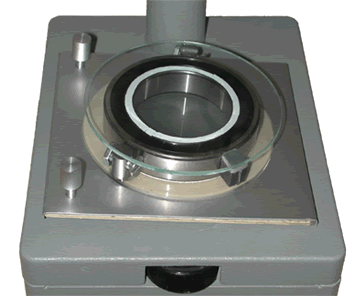

Aufnahmen und Aufnahmetechnik
Einige
Aufnahmen die mit dieser Einrichtung aufge-
Hinweise für die Wahl des
geeigneten Konvergenz-
Kleinere Details der Praxis sind hier nicht ausgeführt. Ich denke, um eigenes
Experimentieren wird man nicht herumkommen, wenn man sich entschließt, den
Drehtisch nachzubauen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass der Bau nicht
schwierig ist. Die hohe Präzision der Drehung ist durch das Kugellager
garantiert, seinem Herzstück. Das macht die Konstruktion auch attraktiv für
den Eigenbau eines Drehtisches für das Durchlichtmikroskop.
Falls Sie Verbesserungsvorschläge zu der vorgestellten Mechanik haben oder
eigene Lösungen realisiert haben, würde ich mich über eine kurze Information
freuen.